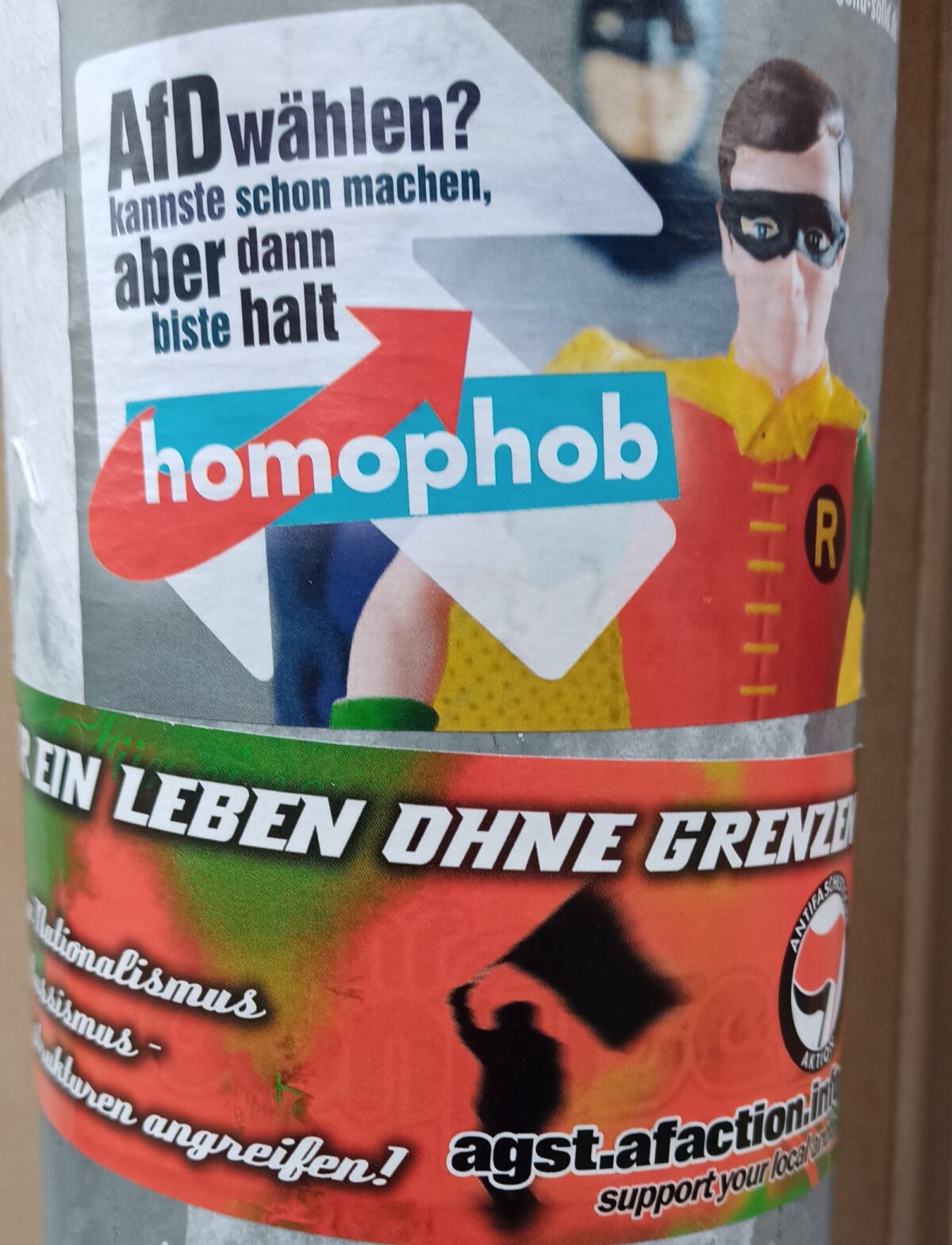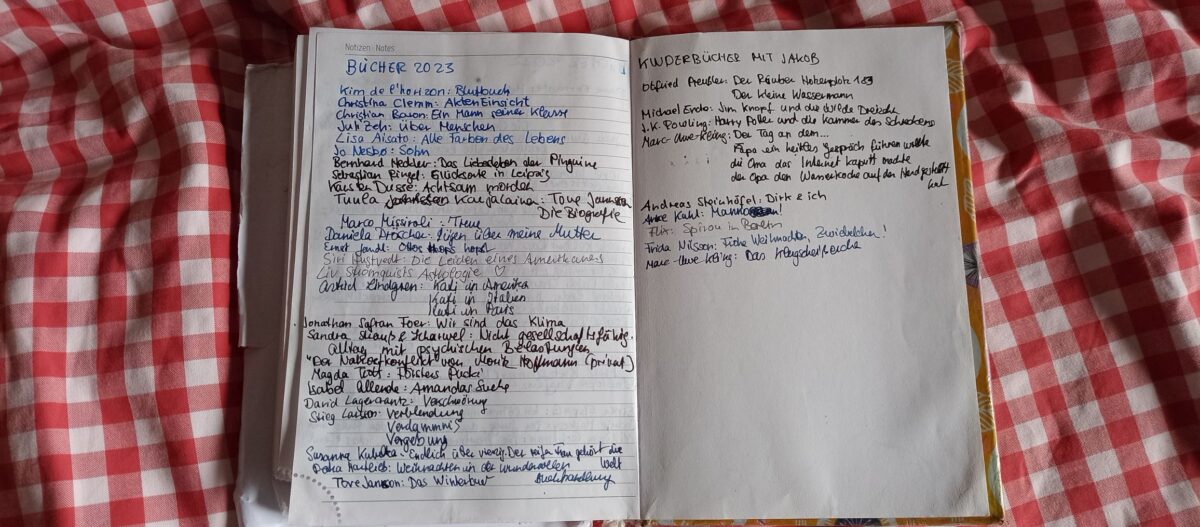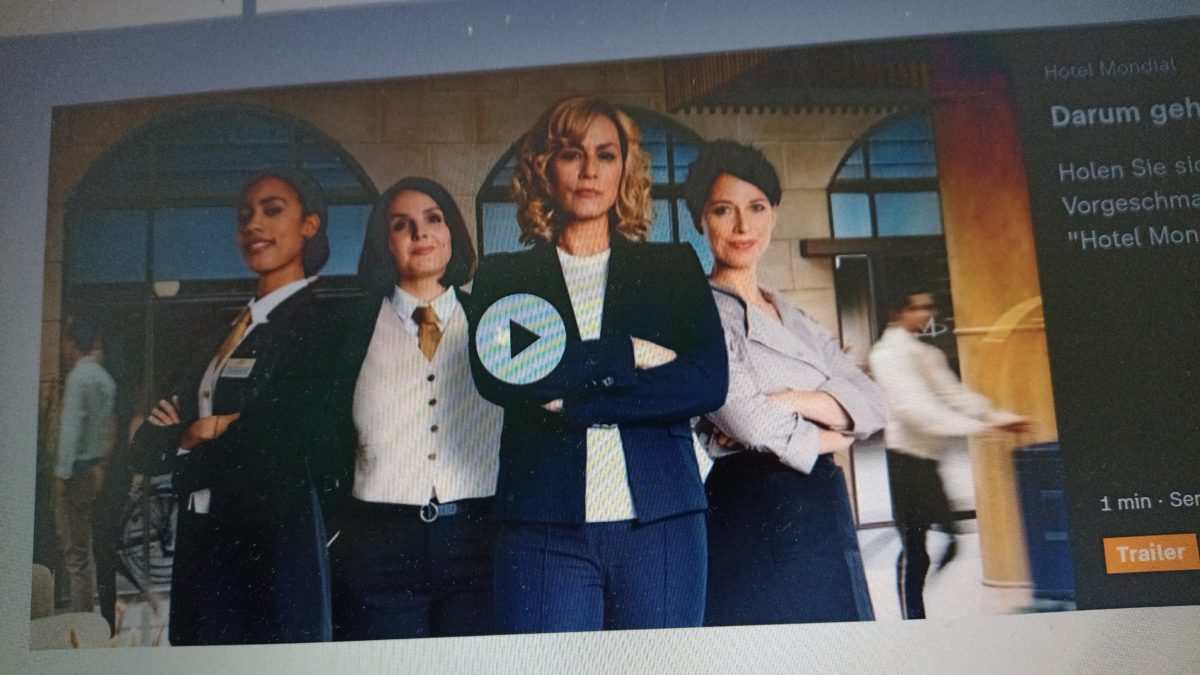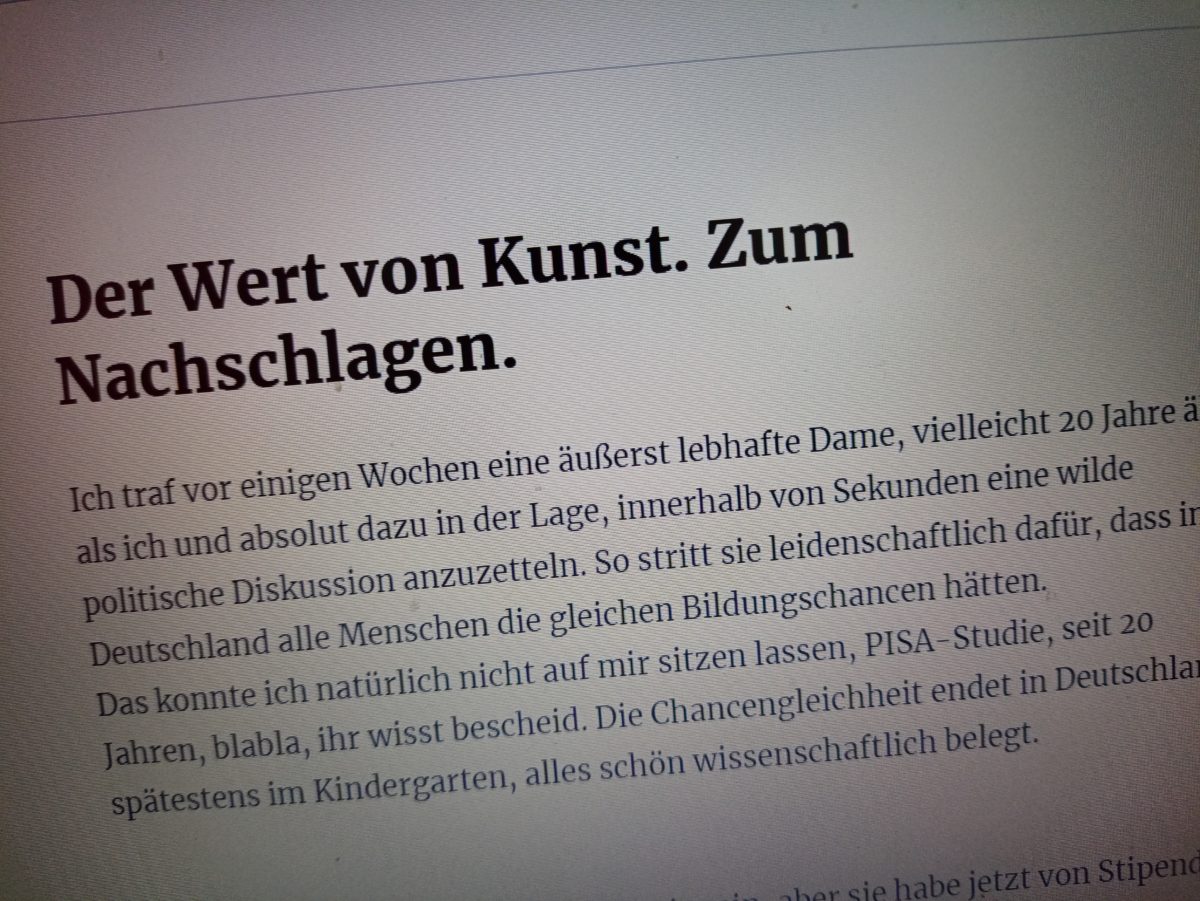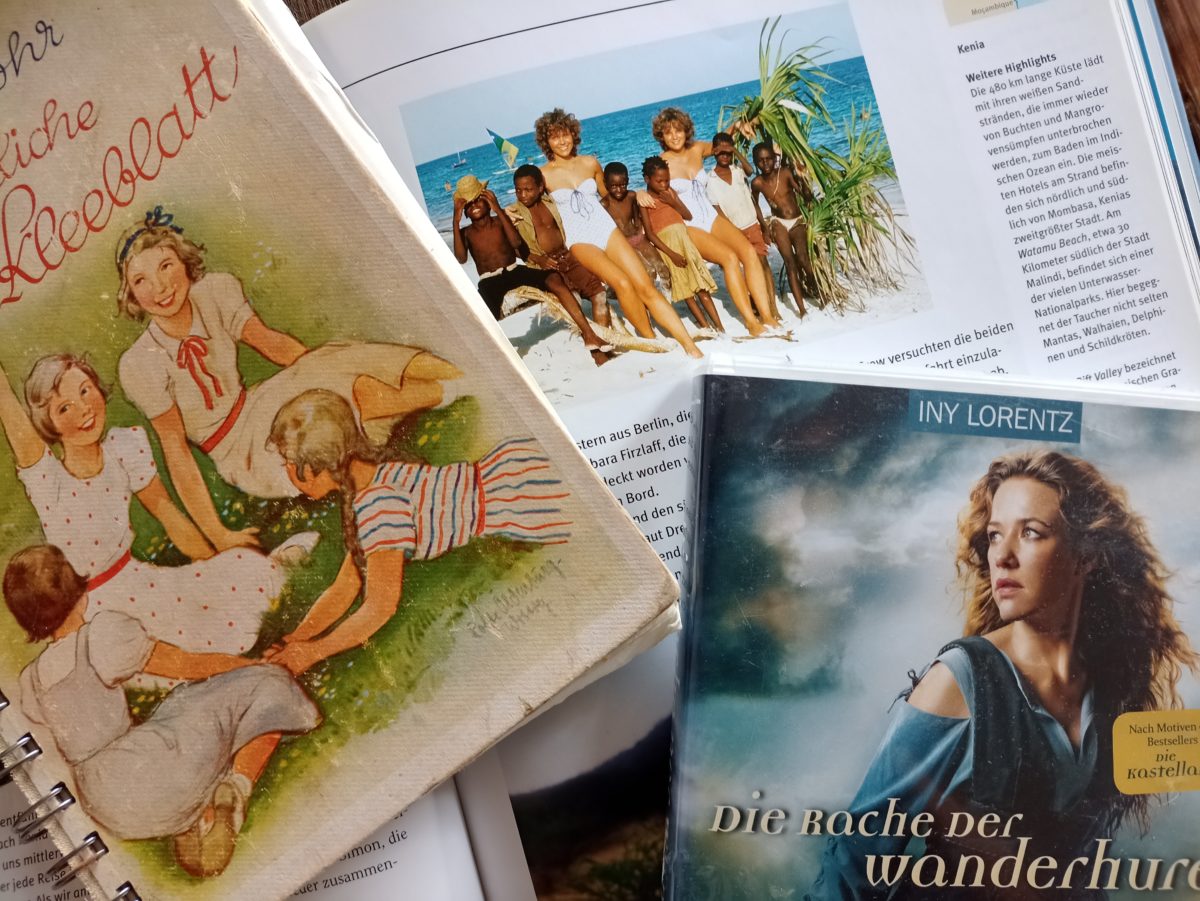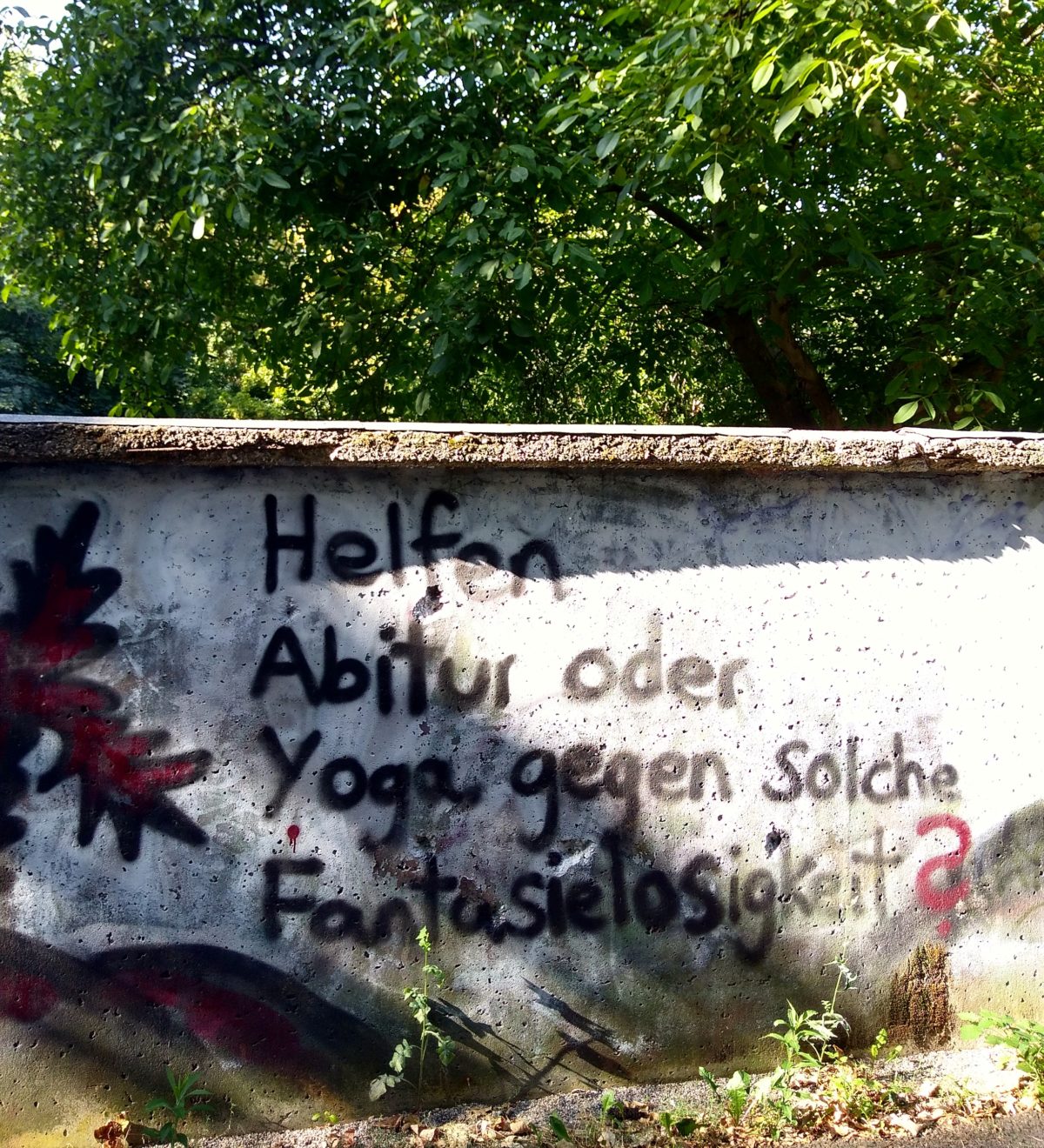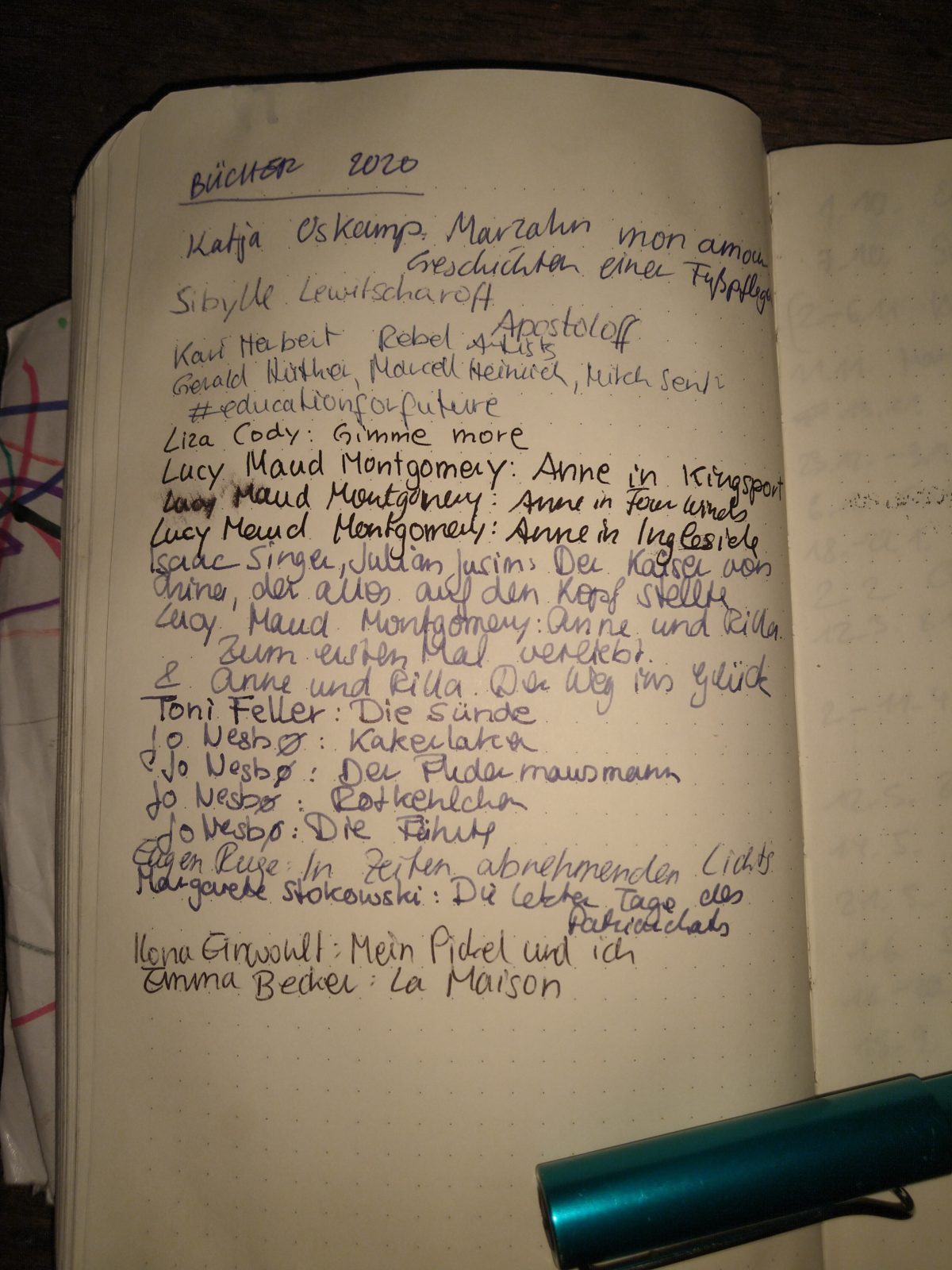1. Kim de l’horizon: Blutbuch. Man hört ja hie und da, der eine/die andere interessiere sich nicht so für non binary-Themen… Aber dieses Buch ist so viel mehr. Wie kann ich sprechen, wenn ich bei grundsätzlichen Kategorien nicht mitmache? Wie erzählen Bäume, Menschen, Sex-Dates, Strickzeug, Hexen? Es geht nicht darum, Rechte einzufordern, es geht darum zu sein. Letztlich für uns alle. Absolute Leseempfehlung.
2. Christina Clemm: Akteneinsicht. Bevor du mit jmd über sexuelle Gewalt diskutierst, ist dieses Buch eine gute Lektüre. Die Frage, warum „das Mädel nicht sofort was gesagt hat“ stellt sich dann nie wieder. Am besten gleich in der Schule lesen.
3. Christian Baron: Ein Mann seiner Klasse. Die authentischen Schilderungen der Armut und Gewalt in der Kindheit des Autors haben mich sehr beschäftigt. Es ist außergewöhnlich, wieviel Wärme er für den/seinen prügelnden Vater aufbringt. Wie er die sozialpolitische Komponente seiner Erfahrungen im Auge behält. Schwer erträglich, wie er etwa vom Jugendamt behandelt wurde. Mit Sicherheit auch ein streitbares Buch, auch wenn ich das gar nicht richtig fassen kann.
Manchmal schwer erträglich.
4. Juli Zeh: Über Menschen. Tolle Dialoge. Völlig übertriebene Erzählungen vom Stadtleben. Schade, dass es der Autorin nicht gelingt, fair zu beidem zu sein.
5. Lisa Aisato: Alle Farben des Lebens. Okay, das ist ein Bildband. Und zwar ein wunderschöner. Schlimme und gute Erfahrungen verdichten sich in 1000 Farben. Bestimmt auch mal kitschig, aber mich macht es froh <3
6. Jo Nesbø: Sohn. Von Zeit zu Zeit habe ich Krimilust. Jo Nesbø ist dann eine absolut gute Wahl.
7. Bernhard Heckler: Das Liebesleben der Pinguine. Ich erinnere mich an erstaunlich wenig. Verschiedene Handlungsstränge wurden verflochten, alles fein, aber nicht so mein Ding, ist nichts persönliches.
8. Sebastian Ringel: Glücksorte in Leipzig. Badezimmerlektüre, enthielt tatsächlich einige Orte, von denen ich noch nie gehört hatte.
9. Karsten Dusse: Achtsam morden. Lustige Grundidee, aber wenn mir ein Mann stundenlang erzählt, wie erfüllend und beglückend es ist, 48 Stunden allein für ein Kleinkind zuständig zu sein, dann steige ich aus.
Beglückte 48 Stunden allein mit einem Kleinkind. Genau.
10. Tuula Karjalainen: Tove Jansson. Die Biographie. Das tollste am Buch sind die vielen farbigen Abbildungen. So eine interessante Künstlerin! Die Autorin wiederholt sich zwar öfter, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Buch.
11. Marco Missiroli: Treue. Im Treppenhaus gefunden, mich gut unterhalten gefühlt.
12. Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter. Frauenfeindlichkeit. In einer bürgerlichen Familie in den 80ern. Kennt man ja? Nein, dieses Gefühl, wenn diese völlig absurden Erniedrigungen der Mutter von der Tochter beobachtet werden, das muss man erstmal aushalten. Bzw. ich. Trotzdem eine absolute Empfehlung!
13. Ernst Jandl: Ottos Mops hopst. Den kleinen Gedichtband habe ich schon seit meiner Kindheit, jetzt feiere ich ihn mit meinem Sohn.
14. Siri Hustvedt: Die Leiden eines Amerikaners. So schöne Figuren, soviel Balance letztendlich. Eine gute Autorin, die nur sparsam Wünsche erfüllt.
Die absurdesten Beziehungen der Welt, so lustig.
15. Liv Strömquists Astrologie. Wollte ich eigentlich verschenken, aber dann habe ich reingelesen, mich kaputt gelacht und es behalten. Ein Panoptikum der absurdesten Beziehungen der Welt, und da gibt es so einige. Gönnt euch!
16. Astrid Lindgren: Kati in Amerika. Kati in Italien. Kati in Paris. „Jungmädchenbücher“ von Astrid Lindgren. Ich finde es einfach hochinteressant, wie Kinder- und Jugendliteratur besehen und bewertet wird. Vielleicht schreibe ich darüber nochmal mehr. Hier schafft die Autorin es jedenfalls, in jedem Satz gleichzeitig progressiv und konservativ zu sein.
17. Jonathan Safran Foer: Wir sind das Klima. Wie immer ein ehrliches, persönliches, mit großer Geste argumentierendes Buch. Und natürlich sind wir das Klima. Nur leider wir alle. Ich wäre sehr gern allein mit Jonathan Safran Foer das Klima. Oder so. Es ist zum heulen.
Für Neue im Psycho-Business.
18. Sandra Strauß, Scharwel: Nicht gesellschaftsfähig. Alltag mit psychischen Belastungen. Ein dicker Wälzer mit einem guten Ansatz. Manchmal etwas gleichförmig, gerade in den vielen Erfahrungsberichten, dazwischen finden sich aber echte Perlen. Auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, um es bei Leuten herumliegen zu lassen, die neu im „Psycho-Business“ sind.
19. Moritz Hoffmann: Der Nahostkonflikt. (privat) Schon vor langer Zeit bat ich meinen Bruder, mir den Nahostkonflikt zu erklären – und bekam als Unikat einen Comic. Leider war es nun mal wieder Zeit, ihn aus dem Regal zu ziehen. Sich die Chronik anzuschauen, macht es nicht besser.
20. Magda Trott: Försters Pucki. Noch so ein Abfuck der Kinderliteratur. Jede Menge seelische Gewalt, aber im Wald, der ist okay. Heidewitzka.
21. Isabell Allende: Amandas Suche. Die Frau kann sich tolle Figuren ausdenken, aber in diesem Roman schwafelt sie – man könnte bestimmt ein Drittel streichen. Wer an sowas Freude hat, der möge beginnen, ich war froh, als ich fertig war.
22. David Lagercrantz: Verschwörung. Fortsetzung der bekannten Reihe von Stig Larsson. Ziemlich grob verfasst, hat mir nicht gefallen. Hatte aber auch Covid.
Krimis mit Hackerin aus der Zeit der CD-Rom.
23. Stig Larsson: Verblendung. Verdammnis. Vergebung. Nach langer Zeit nochmal gelesen… Die Reihe hat den technischen Fortschritt überraschend gut verkraftet.
24. Susanna Kubelka: Endlich über vierzig. Der reifen Frau gehört die Welt. Ein sehr lustiges Geschenk. Und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Feminismus nicht funktionieren kann, wenn man sich ständig be- und abwertet. Alte Frauen sollen einfach aufhören zu jammern. Junge Frauen sollten nicht zu lange stillen, um eine schöne Brust zu behalten. Und alle sollten einfach maßvoll essen und auf jeden Fall Sport machen. Die Männer sollen nix. Klar so weit.
25. Petra Hartlieb: Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung. Noch so ein Treppenhausfund. Das Weihnachtsgeschäft ist sehr anstrengend. Das war’s.
26. Tove Jansson: Das Winterbuch. Gute Erzählungen, allerdings vom Verlag zusammengestellt, und das merkt man, das Buch ist nicht rund. Dennoch: Lest Tove Jansson!
Und jetzt noch Kinderbücher:
27. Otfried Preußler: Der Räuber Hotzenplotz 1&3, Der Wassermann. Mit meinem Sohn gelesen/gehört. Einfach ein toller Autor.
28. Michael Ende: Jim Knopf und die wilde Dreizehn. Siehe oben, auch wenn in Bezug auf die Hautfarbe von Jim kurz was besprochen werden musste… Aber mein Sohn winkt da bloß ab, er weiß das alles.
29. J. K. Rowling: Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Siehe oben. Auch hier beschäftigt mich die Kritik, die neuerdings überall zu lesen ist. Ein wirklich interessantes Thema.
30. Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte/die Oma das Internet kaputt machte/der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat/Tiffany das Wasser aus der Wanne geschaukelt hat. Alles so lustig, gehört zum Repertoire unserer Familienparty.
31. Andreas Steinhöfel: Dirk und ich. Auch so ein Buch, dass uns immer zum lachen bringt
32. Anke Kuhl: Mannomann. Gute Familiencomics, witzig, aber auch voll der Härten des Kindseins.
33. Flix: Spirou in Berlin. Sehr klug, sehr witzig, sehr Kenntnisse voraussetzend. Urteil meines Sohns: Das ist wohl eigentlich nichts für Kinder.
34. Frida Nilsson: Frohe Weihnachten, Zwiebelchen. Gar nicht so leicht, als sechsjähriger Probleme zu lösen, die die Erwachsenen selber nicht geklärt kriegen. Zwiebelchen macht dabei einige Fehler, und er ist so sympathisch dabei – es war richtig kuschelig, dieses Buch zusammen zu lesen.
35. Marc-Uwe Kling: Das Klugscheißerchen. Kleine Geschichte, runde Sache, sehr gut vorlesbar. Kann man machen.
Das waren meine Bücher 2023.
Und das waren sie, meine Bücher 2023. Einen Bilderbuchtipp für Kleine und Große schiebe ich hinterher: „Kunst aufräumen“ von Ursus Wehrli. Einfach eine gute Idee. Ich räume jetzt mein Bücherregal auf… Oder mache ich mich vielleicht endlich mal wieder an meinen eigenen Text?
Wie auch immer: Frohes Neues! Und lest schön…