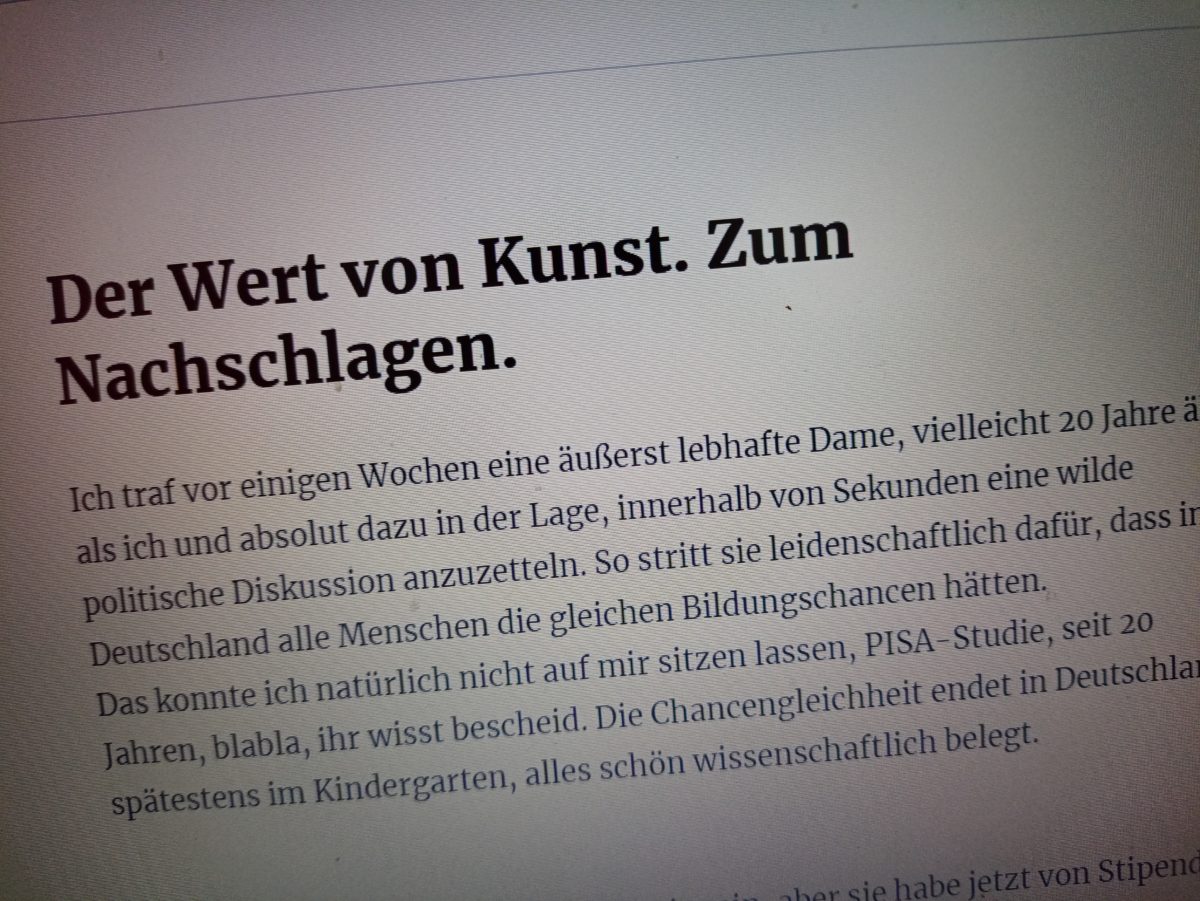Ich traf vor einigen Wochen eine äußerst lebhafte Dame, vielleicht 20 Jahre älter als ich und absolut dazu in der Lage, innerhalb von Sekunden eine wilde politische Diskussion anzuzetteln. So stritt sie leidenschaftlich dafür, dass in Deutschland alle Menschen die gleichen Bildungschancen hätten.
Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, PISA-Studie, seit 20 Jahren, blabla, ihr wisst bescheid. Die Chancengleichheit endet in Deutschland spätestens in der Grundschule, alles schön wissenschaftlich belegt.
Ja, hob die Dame wieder an, das möge ja sein, aber sie habe jetzt von Stipendien geprochen, also von der Chancengleichheit im Rahmen eines Universitätsstudiums, da gäbe es doch nun wirklich alle Möglichkeiten.
Hä? Das überraschte mich ja nun wirklich. Also in meinem Studium, wandte ich ein, da hätten ja nun die wenigsten ein Stipendium gehabt, so endlose Möglichkeiten habe es da nicht gegeben… – Jaaaa, antwortete meine Gesprächspartnerin, da müsse man dann natürlich auch Leistung bringen, das sei ja klar!
Was haben Sie denn studiert?
Vor meinem inneren Auge zogen Kommilitonen vorbei, deren Magisterarbeiten den Umfang von Doktorarbeiten hatten, die Monat um Monat in unbezahlten Praktika verbrachten, die auf eigene Kosten nach Berlin fuhren um irgendwelche Inszenierungen anzugucken…
Also ich habe mit 1,1 abgeschlossen, ich glaube nicht, dass es da jetzt um die Leistung geht, antwortete ich leicht zickig.
Was haben Sie denn studiert?
Theater- und Erziehungswissenschaften.
Achsooo… Nun ja, man sollte dann auch schon etwas studieren, was von allgemeinem Interesse ist, was auch gebraucht wird, das ist auch die Aufgabe der Eltern, darauf hinzuwirken, dass ihre Kinder etwas studieren, wovon man auch leben kann…
An dieser Stelle steuere ich die Unterhaltung mal langsam aus. Sie findet natürlich täglich irgendwo statt, permanent müssen sich Menschen dafür verantworten, dass sie einen nutzlosen Job machen und selber schuld sind, dass sie in prekären Lebensumständen lernen und leben. Ich habe keine Lust mehr, das zu diskutieren. Ich schreibe meine Antwort nun einmal hier auf und werde dann in Zukunft nur noch den Link teilen. Schluss damit, mich immer wieder zu wiederholen.
Fakt ist, dass eine Gesellschaft aus vielen Menschen besteht, die miteinander klarkommen müssen.
Also: Gibt es sie, die brotlosen Künste? Na klar! Meine EU-Rente beträgt 600€. Ein Witz.
Kann man daraus ableiten, dass künstlerische Arbeit wertlos ist?
Nein. Natürlich, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist aber immerhin schon der zweite Platz, da hat noch keiner seine Steuererklärung gemacht oder den Rasen gemäht.
Fakt ist, dass eine Gesellschaft aus vielen Menschen besteht, die miteinander klarkommen müssen. Aus Identitäten, aus Einzelpersonen und Gemeinschaften. Und es ist absolut wichtig, sich auf all diesen Ebenen zu spüren, kennenzulernen, miteinander umzugehen. Sonst funktioniert das System nicht. Oder es funktioniert eben zu gut.
In einer sächsischen Kleinstadt mit größtenteils rechtsoffenen Bürger_innen wird es immer auch Menschen geben, die sich in dieser Mehrheitsgesellschaft nicht wiederfinden, die anders denken oder fühlen. Die treffen sich nicht im Ingenieursbüro oder in der Anwaltskanzlei. Die treffen sich bei Künstler_innen und Geschichtenerzähler_innen. Bei Sozialpädagog_innen, vielleicht auch in Therapiegruppen. Manchmal in Religionsgemeinschaften. Fast immer bei unterbezahlten Menschen. Wenn es sie nicht gäbe, gäbe es dafür keinen Raum, und ich bin sicher, dass uns der Laden wesentlich häufiger um die Ohren fliegen würde. Vermutlich gibt es auch deshalb ein Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe.
Und das war`s. Eine bessere Bezahlung wäre wünschenswert, aber vorerst wäre es auch schon nett, wenn der Wert von Kunst nicht mehr permanent in Frage gestellt würde. Herzlichen Dank dafür, auch an die Dame, die mir diese Steilvorlage geschenkt hat. Liebe Grüße! Sol