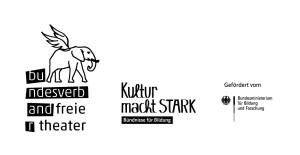„I think you forgot me“ – so begrüßte mich am letzten Mittwoch ein schwer von Narben gezeichneter Mann im Asylbewerberheim in der Torgauer Straße. Wir hatten uns schon mal unterhalten. Er lächelt fortwährend, spricht überaus freundlich auf englisch, er ist allein in Deutschland und sucht dringend eine Wohnung. Vor einigen Wochen bat er mich dabei um Hilfe. Ich sagte ihm, dass ich mich umhören würde, ihm aber nichts versprechen könne, denn solche Gespräche führe ich immer wieder, und ich habe leider einfach keine Wohnungen. Und auch nicht die Kapazitäten, allen die fragen bei der Wohnungssuche zu helfen. Ich schaffe es nicht. Es sind zu viele.
Zu viele? Moment mal!
„Wenn wir jetzt sagen “Ihr könnt alle kommen”, und “Ihr könnt alle aus Afrika kommen” und “Ihr könnt alle kommen”, das können wir auch nicht schaffen.“ Quelle: Leitmedium
Einen Tag später ging das Video des Gesprächs zwischen der Bundeskanzlerin und einem Mädchen mit Fluchthintergrund durchs Netz. Und ich sage es mal andersrum als viele andere: Sie war keinen Deut besser als ich.
Natürlich hat sie in ihrer Position einen größeren Gestaltungsspielraum, und ich freue mich sehr, wenn die katastrophale Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ins Blickfeld gerückt wird. Wenn der hashtag #merkelstreichelt trendet, steckt da neben wichtiger Kritik aber auch richtig viel Schadenfreude drin. Man gönnt es der Merkel, jetzt PR-mäßig mal schön in der Klemme zu stecken. Ich gönne es ihr auch, immer druff.
Unangenehm ist mir aber, dass das Bild eines Mädchens, das seinen Standpunkt mutig und eloquent vertreten hat, jetzt als „weinendes Flüchtlingsmädchen“ rumgereicht wird. Unangenehm ist mir auch der Gedanke, dass der eingangs erwähnte Mann mit seinen sichtbaren und unsichtbaren Narben vermutlich nicht dazu taugen würde, Merkel derart in Verlegenheit zu bringen. Und der angetrunkene Mann, der 2 Bänke weiter saß sowieso nicht. Kein gutes Kameramaterial.
Wir freuen uns, dass echtes menschliches Fühlen eine PR-Aktion sprengt? Ich bin dabei! Aber das sollte dann bitte auch menschliche Folgen haben: Nicht ähnliche PR aus der anderen Richtung.
Das kann es doch nicht gewesen sein.
PS: Der Moderator des Gesprächs, Felix Seibert-Daiker, war spitze!