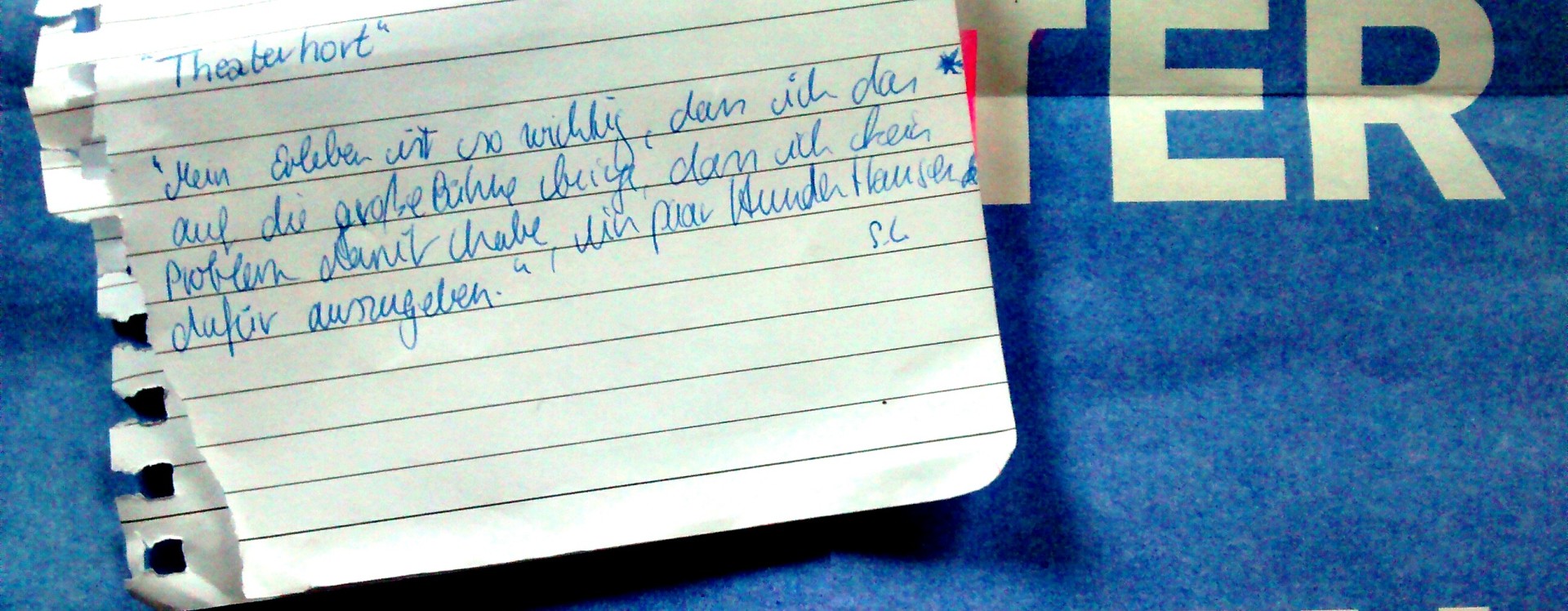Eine intensive Woche ist vorbei. Wie immer, wenn mir ein Projekt besonders am Herzen liegt, habe ich mich übernommen und bin krank: Diesen Artikel tippe ich mit Sehnenscheidenentzündung und deshalb mit links.
Trotz Stress und Reibungsverlusten haben wir aber Ergebnisse, die ich fast in einen Umschlag stecken und nach Berlin schicken möchte. Denn wenn man nur wenige gemeinsame Worte und keine gemeinsame Sprache hat, dann heißt es Farbe bekennen: Ja oder nein? Gut oder nicht gut? Chef oder nicht Chef? Eine soziale Anstrengung, aber auch eine künstlerische Chance.
Einige Momentaufnahmen:
Tag 1
Solveig: Das hier ist ja ein Land…
5 Kinder: Wer Chef?
Die Chefposition wird uns die ganze Woche lang beschäftigen. Schnell wird klar, dass diese mächtige Position nicht so mächtig ist, wie die pädagogische Diktatur, die im Hintergrund die Wahl leitet, anregt, dass die Chefs bestimmte Aufgaben erfüllen etc. Könnten wir das anders machen? Uns ist daran gelegen, das Zusammenleben in unserem Staat, unser ganzes Experiment, erträglich zu gestalten. Wir greifen alles auf, was von den Kindern kommt, aber wir geben eben auch Input: Die Chefs (es sind täglich 2, immer frisch gewählt) werden so schnell für Entscheidungen zuständig, die alle betreffen, werden bei Streitigkeiten gerufen und erhalten natürlich auch viel Aufmerksamkeit.
Fast alle wollen Chef werden.
Tag 2: Das System funktioniert. Erster Unmut entsteht allerdings durch die mangelnde Gewaltenteilung: Wenn die Chefs auch Kochen, haben sie zuviel Macht.
Tag 3: Die ersten Petitionen tauchen auf. Lustigerweise oft erstellt von den Chefs. Dabei wird schnell deutlich, dass es nicht für alles, was ein Chef will, auch Mehrheiten gibt. Überhaupt hängt die Macht der Chefs stark von der Gunst der Bienengesellschaft ab.
Kinder, die große Sprachprobleme haben, haben zudem keine echte Chance, zum Chef gewählt zu werden: Verständlich, aber auch frustrierend. Die einzige Position, die ohne Sprache erfüllbar scheint, ist die eines Polizeichefs: Die Rolle wird so interpretiert, einzelne Bereiche durch auf und abgehen zu kontrollieren. Polizei spielen um mit einbezogen zu werden? Die Erwachsenen müssen lachen. Und doch ist das ein interessanter Blick auf diese Position, immerhin von einem Kind, das hierher geflüchtet ist, und mit der Polizei vermutlich einige Erfahrungen hat.
Tag 4: Die Chefs machen nichts. Dinge gehen kaputt. Krisensitzung! Alle fühlen, dass es so nicht weitergehen kann.
Erkenntnis 1: Wir brauchen Chefs, die auf Streit spezialisiert sind!
Die wichtigste Position im Bienenland ist eine Schlichtungsposition. Kein Durchsetzen, kein Bestimmen: Wir brauchen jemanden, der wirkungsvoll schlichten kann. Das geht weit über ein juristisches Entscheiden hinaus, SchlichterInnen kümmern sich um den sozialen Frieden. Ich sehe keine derartige Position auf Bundesebene, die derart Rückhalt hätte, wie unsere Streitchefs. Ein Verbesserungsvorschlag.
Tag 5: Wahl der neuen Chefs. Mit einem ganz klaren neuen Ansatz: Jeder möchte Chef sein und eine Verantwortung übernehmen, die ihm oder ihr auch etwas wert ist. Wir können die Kinder nicht mehr mit symbolischen Positionen abspeisen. Heute bestimmen wir gemeinsam in einem nicht mehr nachvollziehbaren Prozess, mit dem aber alle zufrieden waren: Chefs Streit: deutsch und arabisch-sprachig; Sportchefs: für Ball und Boxsack; Chef Feuer (zusammen mit Solveig); Chefs Kekse und Einkauf von Keksen; Chef Wii; Hausmeister; Küchenchef; Farbenchef
Erkenntnis 2: Alle Bürger fordern lautstark ihre Verantwortung ein. Jede und jeder will ein Amt!
Hier gibt es keine Politikverdrossenheit, aber großen Ärger, wenn jemand bei der Ämterverteilung zu kurz kommt. Lässt sich das auf bestimmte Bevölkerungsschichten in Bundesdeutschland übertragen?
Jedenfalls werde ich nie mehr leichtfertig Verantwortlichkeiten einschränken.
Tag 6: Präsentation. Eine Party, ein Chaos, ein ekstatisches Schwenken der Bienenfahne. Es gäbe noch viel viel mehr zu erzählen. Wir hoffen auf die Anschlussförderung, denn die neue Chefregelung hat sich ja nun erst einen Tag bewähren müssen.
Was vorerst bleibt: Wir haben einen Staat gegründet, in dem heftig gestritten und laut gefeiert wurde. Die Sprachschwierigkeiten waren für alle aufreibend, kulturelle Unterschiede natürlich auch. Es hat aber funktioniert. Mit wenigen Gesetzen, viel Gerangel um Positionen – und schließlich auch mit einem florierenden Postwesen, einer derben Inflation, bevor das Geld wieder abgeschafft wurde und Pässen, die sich interessierte Bürger einfach selber herstellen konnten.
In diesem Sinne: Wenn ihr einreisen wollt, dann macht euch einen Pass und werdet Bürger.
Das Bienenland ist ganz sicher nicht der schlechteste Ort. Zum Leben und zum Summen.