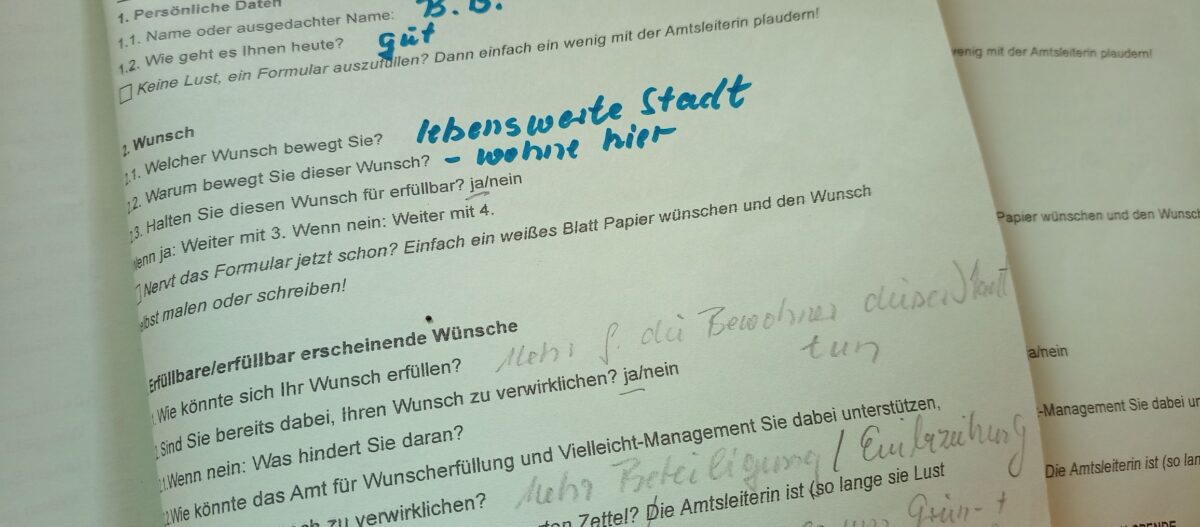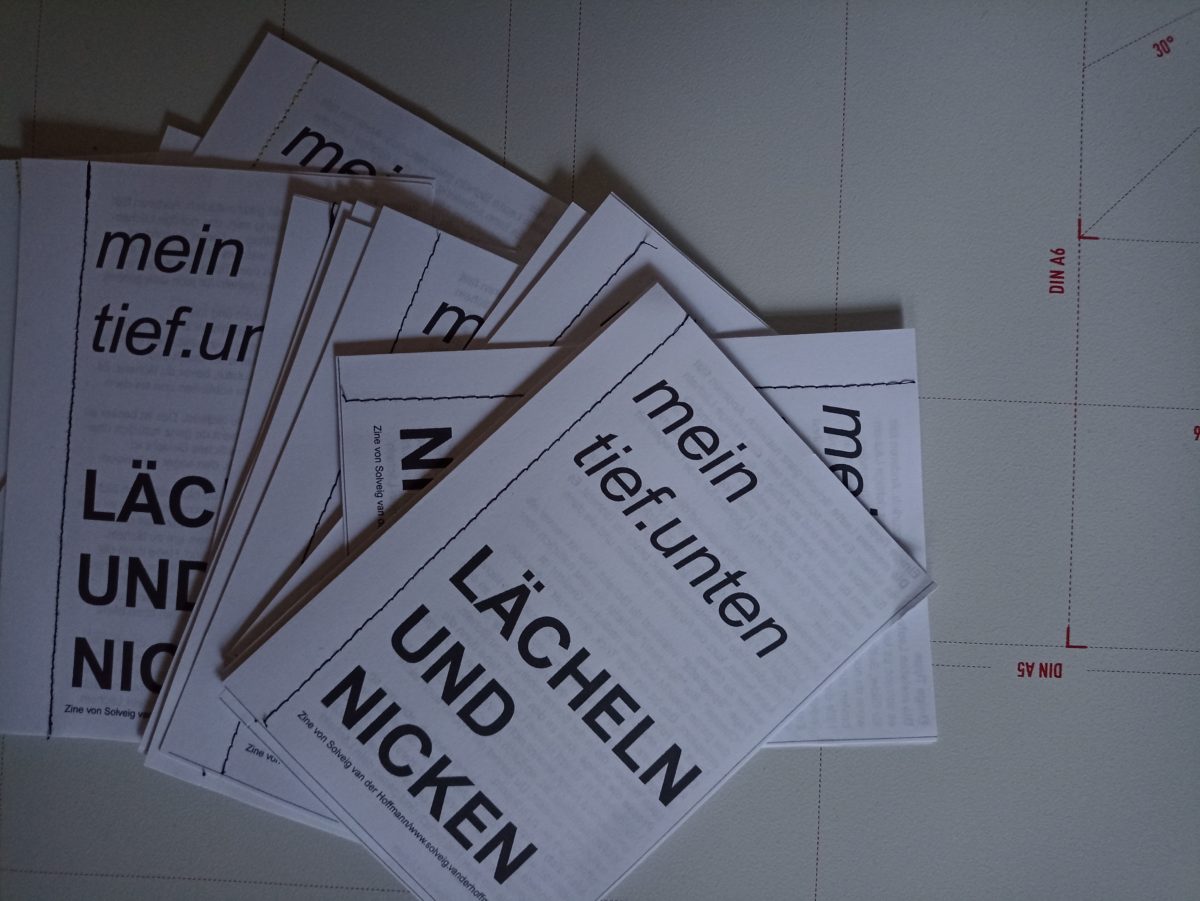Kannst du Depression? Ich schon. Und das ohne Anleitung. (Tadaa!)
Die Depression, ich lebe mit ihr, werde mit ihr leben. My beloved monster and me. Ich füttere es, ich putze hinter ihm her und manchmal lache ich über seine drolligen moves. Oder ich halte es kaum aus. All das.
Das alles schaffe ich, weil ich unheimlich viel Hilfe habe. Und diese Hilfe habe ich, weil ich mich selbst darum kümmere. Sogar an absoluten Tiefpunkten habe ich Kontakte recherchiert, angerufen, mich durchgefragt, das ist meine persönliche Ressource, viele können das nicht. Und es ist auch nicht so, dass irgendjemand einem einfach eine Liste mit allen Hilfsangeboten überreicht – jede_r weiß nur immer ein kleines bisschen, und da wühlt man sich dann so durch. Ich würde mal relativ selbstbewusst behaupten, dass keine einzige der Personen, die mit mir und meiner Erkrankung befasst sind, all die Hilfsangeboten kennt, die ich kenne. Das ist ein Problem.
Leute, die mit ihrer ersten Depression ein paar Wochen im Krankenhaus landen, dann mit einer großen Medikamentenschachtel nach Hause gehen und fertig.
Denn, machen wir uns nichts vor, es gibt genug Leute, die mit ihrer ersten Depression ein paar Wochen im Krankenhaus landen, dann mit einer großen Medikamentenschachtel nach Hause gehen und fertig. Ohne Therapie (Wartezeiten…), ohne Tagesstruktur (mal einen Kuchen backen reicht nicht). Also geht es zurück ins Krankenhaus, und so müssen diese Menschen Stück für Stück auf die harte Tour lernen, wie sie sich selbst helfen können. Ich finde das furchtbar.
Mehr als einmal habe ich mit lieben Menschen zusammengesessen und mein Wissen geteilt, auch oft nochmal Neues von meinem Gegenüber erfahren. Also, habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt einfach mal digital: Depressionswissen zum verlinken und vervollständigen. Selbstverständlich stellen meine Erfahrungen keine medizinische Beratung dar. Im Idealfall machen sie euch die Recherche etwas leichter. Viele konkrete Adressen beziehen sich auf Leipzig, aber manche allgemeine Erklärungen helfen vielleicht auch andernorts weiter. Und über Ergänzungen eurerseits freue ich mich! Also los:
Zur Diagnostik.
Habe ich überhaupt eine Depression? Nun ja, da gibt es eine ganz Reihe Symptome, und das Krankheitsbild kann ganz schön unterschiedlich aussehen. Jedenfalls kann die Schwester des Freundes von deinem Arbeitskollegen das wahrscheinlich nicht korrekt einschätzen. Seriöse Infos gibt es z.B. hier: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start Richtig gut finde ich das Info-Telefon Depression (bei den Angeboten), weil man da eben auch wirklich mit Fachleuten spricht und diese Beratung jederzeit verfügbar ist. Das kann auch für Angehörige hilfreich sein.
Die Diagnose stellt dann ein_e Ärzt_in oder Therapeut_in. Du kannst einfach zum_zur Hausärzt_in gehen, oder eben zum_zur Psychiater_in. Es schadet nicht, am Telefon die Dringlichkeit zu betonen! Endlose Wartezeiten sind nicht hilfreich! In den meisten Therapien geht es früher oder später um das Selbstwertgefühl – du musst das aber nicht abwarten, um für dich einzutreten. Denn das Gesundheitssystem wartet leider nicht auf Menschen mit psychischen Krankheiten. Im Zweifel bitte eine vertraute Person, dir dabei zu helfen, dich durchzusetzen. Lieber einen Vormittag im Wartezimmer warten, als 6 Monate zu Hause im Bett.
Hausärzt_in/Psychiater_in werden dir dann möglicherweise Medikamente anbieten und verschreiben und eine Therapie empfehlen. Viele Psychiater_innen sind auch Psychotherapeut_innen – das heißt aber nicht, dass sie auch als solche praktizieren (wäre wahrscheinlich auch eine finanziell schlechte Entscheidung). Es schadet aber nichts, nach Tipps und Adressen für die Therapeut_innensuche zu fragen. Und dann heißt es auch hier wieder: anrufen. Es lohnt sich häufig, in den fünf Minuten vor der vollen Stunde anzurufen, da viele Therapeut_innen dann erreichbar sind. Manchmal haben sie auch eine wöchentliche Telefonsprechstunde. Die Krankenkasse bezahlt 5 „Probestunden“, in denen du die Therapeut_innen erstmal kennenlernen kannst, es schadet also nichts, mehrere Termine auszumachen. Schließich solltest du mit der Person auch gut zusammenarbeiten können.
Und dann?
Wie sieht die Behandlung aus? Natürlich kann ich hier keine medizinischen Empfehlungen abgeben, ich bin keine Ärztin. Die Behandlung besteht in der Regel aus Medikamenten und/oder Psychotherapie. Bei den Medikamenten muss man meistens ein paar Wochen warten um zu wissen, ob sie bei einem wirken, das ist ätzend. Natürlich gibt es im Einzelfall auch Sachen, die zur Überbrückung gegeben werden, etwa um Panikattacken abzufangen. Das muss du mit dem_der Ärzt_in besprechen. Sehr häufig haben Menschen Angst, dass Psychopharmaka ihre Persönlichkeiten verändern könnten – das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Die Nebenwirkungen können wirklich nerven, aber du bleibst du selbst. Zur Psychotherapie kannst du dir hier einen Überblick verschaffen: https://www.therapie.de/psyche/info/ Die Wartezeiten können extrem sein. Es lohnt sich herauszufinden, ob es ein Ausbildungsinstitut für Therapeut_innen in der Nähe gibt – da kriegt man oft schneller einen Platz, die angehenden Therapeut_innen sind motiviert und erhalten engmaschiger Supervision. In Leipzig gibt es da z.B. das https://www.spp-benedek.de/ . Falls du genug Geld hast, kann es auch je nach Problemlage richtig gut sein, sich jemanden zu suchen, der eine nicht von der Krankenkasse finanzierte Therapieform anbietet (Kunsttherapie, Körperpsychotherapie, systemische Therapie etc.). Das Geld kann man sich über die Gesundheitskosten teilweise bei der Steuer wieder reinholen. Allerdings würde ich für mich darauf achten, dass die Person Psychologie oder Medizin studiert hat bzw. einfach seriös arbeitet. Es geht um die Behandlung einer schweren Krankheit, nicht um Wellness.
Und dann noch eine kleine Erfahrung: Du hast monatelang auf das Erstgespräch gewartet, weitere Erstgespräche gibt es nicht mehr, das hier muss jetzt klappen. Du unterhältst dich mit der Therapeutin. Sie lacht, du lachst, du gehst. Mist. Das kann nicht klappen. Die ist viel zu nett. – Es kann eine sehr gute Idee sein, seine Bedenken zu äußern. Ohne Ehrlichkeit keine Therapie (was nicht heißt, dass man alles über sich erzählen muss). Die skizzierte Geschichte ging gut aus und die Frau hat mir dann über ein Jahr lang richtig gut geholfen.
Das reicht alles nicht. Spätestens bei einem sehr hohen Leidensdruck, bei Suizidgedanken etc. (mit Ärzt_in sprechen!) könnte es sinnvoll sein, in eine Klinik zu gehen. Entweder aus einem Notfall heraus oder geplant auf eine Depressionsstation – oder, einigermaßen stabil, auf eine Therapiestation zur stationären Psychotherapie. Zunächst ein paar Worte zur „Klapse“ – viele schämen sich sehr dafür in die Psychiatrie zu gehen. Irgendwie sitzt uns diese Scham wohl allen in den Knochen. Das ist nicht nötig. Ich habe dort schon eine frühere Chefin, den Ex-Freund meiner Regie-Assistentin und einige so nette und kluge Menschen getroffen, wie man es sich nur wünschen kann. Natürlich waren das nicht alle, aber eben doch viele. Und: In der Psychiatrie darfst du dich jederzeit schlecht fühlen. Kein Zusammenreißen. Kein Lächeln, wenn einem zum Heulen ist. Wenn das „die Gesunden“ wüssten… die würden uns die Plätze wegnehmen.
Im Notfall.
Ein paar Erfahrungen: Die Städte sind in Sektoren eingeteilt – für jeden Sektor ist ein Krankenhaus zuständig. Falls du als Notfall eingewiesen wirst und in deiner Wunschklinik kein Bett frei ist, geht es in deine zuständige Klinik. Welches Bett du dann erwischst ist Glückssache – am besten auf einer Depressionsstation, denn da ist es in der Regel ruhig. Wenn du deine Aufnahme planen kannst, dann steigt natürlich auch die Chance auf einen Platz in deiner Wunschklinik. Auf der Depressionsstation gibt es dann in der Regel einen einigermaßen strukturierten Tagesablauf mit leichtem Sport, Ergotherapie, Psychoedukation, evtl. Gruppentherapien… und sehr viel Leerlauf. Außerdem (mit deinem Einverständnis) Medikamente. Und hoffentlich Einzeltherapie. Das kommt (meiner Meinung nach) oft viel zu kurz – oft wird die Meinung vertreten, dass man erst durch die Medikamente überhaupt in die Lage kommt, eine Therapie zu machen. Das mag sein, aber ich persönlich finde, dass ich für mich eine_n Gesprächspartner_in brauche, um den Zustand, in dem ich mich befinde überhaupt einzuordnen und mich nicht noch weiter reinzusteigern. Das habe ich auch immer wieder gesagt, bis ich (kurze) Gespräche bekommen habe. Also: Lasst euch nicht abwimmeln!
Eine stationäre Psychotherapie ist natürlich eine andere Sache. Auch hier muss man erstmal einen Platz kriegen (seufz), aber dann hat man 10-12 Wochen richtig intensiv Therapie, Einzel, Gruppe, Kunst, Sport, Musik und was auch immer. Da kann man viel über sich lernen und diese Erfahrung würde ich eigentlich jedem_jeder gönnen, krank oder nicht.
Das sind die Kliniken in Leipzig: https://www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/psychiatrie-psychotherapie (Hier sitzt übrigens die psychiatrische Institutsambulanz – hier kann jede_r ohne Termin kommen, wenn es ihm_ihr schlecht geht. Wenn du also keine_n Psychiater_in findest, ist das die Möglichkeit der Wahl. Behandelt wird ambulant, aber der Weg auf Station ist natürlich schnell organisiert, wenn nötig.) Die stationäre Psychotherapie gibt es hier: https://www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/psychosomatik Dann gibt es noch das Parkkrankenhaus: https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/leipzig-park-klinikum/unser-angebot/unsere-fachbereiche/psychiatrie/ , ebenfalls mit Depressionesstation und Therapiestation. Und dann noch Altscherbitz: https://www.skh-altscherbitz.sachsen.de/medizinische-einrichtungen/kliniken/klinik-fuer-psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/
Und das soll’s für heute erstmal sein. Falls ihr noch Interesse an weiteren Infos uns Erfahrungen habt – z.B. zu postpartaler Depression, Depression und Kinder und Familie, einfachen Alltagsstrategien und Tipps für Angehörige – dann gebt bescheid. Und bis dahin – tut was euch gut tut. Und lasst weg, was euch schadet! Gute Besserung.